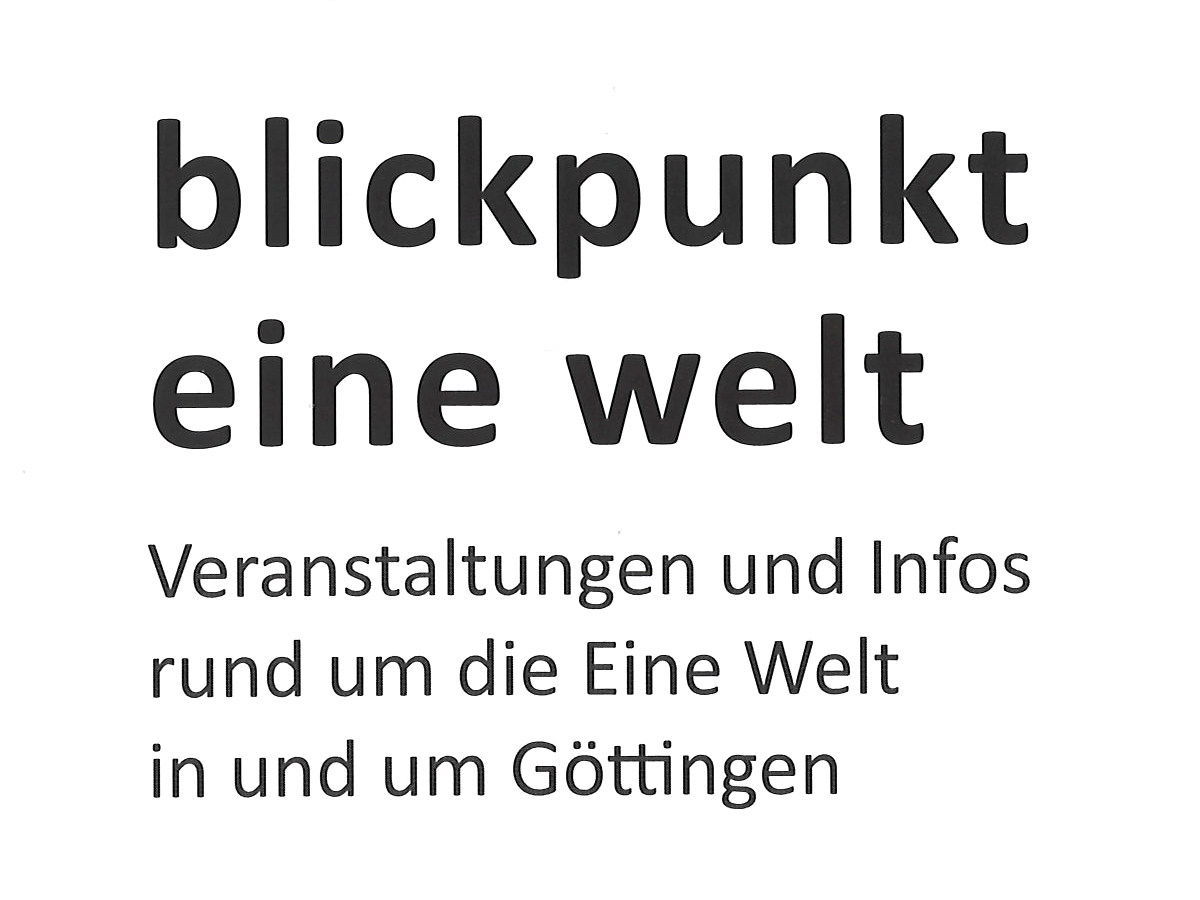Wir sind ein unabhängiges Institut und arbeiten als gemeinnütziger Verein seit 1988 in den Bereichen der entwicklungspolitischen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit sowie der Migrationspolitik. Die 17 weltweiten Nachhaltigkeitsziele bilden unseren Handlungsrahmen. Wir setzen Aktivitäten des Globalen Lernens und der Bildung für nachhaltige Entwicklung um und beraten Asylsuchende im Landkreis Northeim. Wir tragen unsere Themen über Vernetzung und Kooperationen projektorientiert an verschiedene Zielgruppen heran. Wir sind offen für Ideen und neue Projekte. Besuchen Sie unsere Projektseiten.
Erfahren Sie hier mehr über uns.
MITMACHEN
VERNETZEN
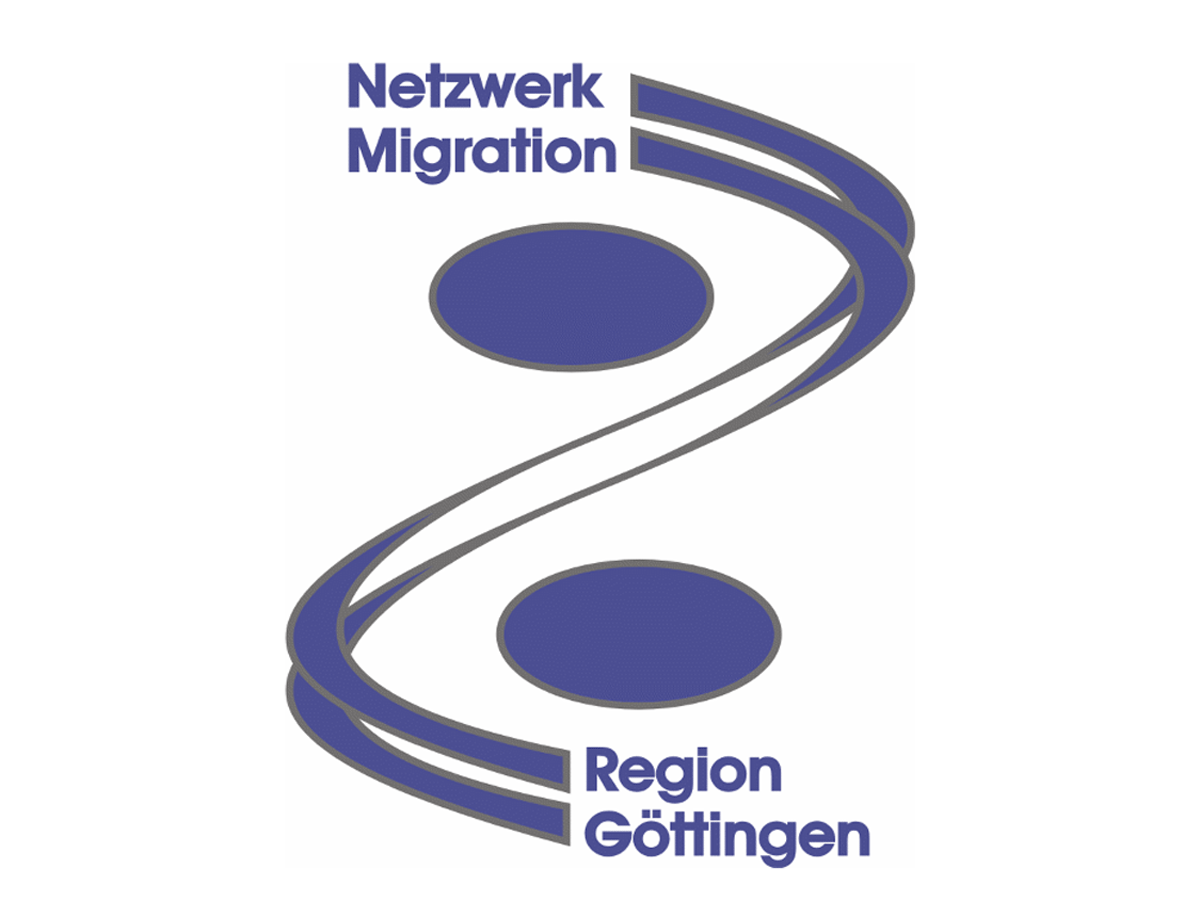
Engagiert mit 50 Organisationen aus Stadt und Landkreis Göttingen